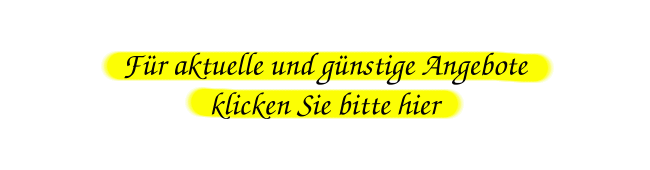- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank
- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube
- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung
- Pflanzenkläranlagen nach DWA
- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben
- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben
- Regenwasser-Zisterne Beton
- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff
- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung
- Wartung Dichtheitsprüfung
- Baden-Württemberg 07903 4060645
- Hamburg 040 29850918
- Niedersachsen 05199 9983960
- Sachsen 034298 480500
(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)
Zubehör für Sammel- und Klärbehälter


 Tank-Abdeckungen
Tank-Abdeckungen
Thermodeckel TopCover (begehbar):
stabiler PE-Thermodeckel mit Kindersicherung. Dauerhaft belastbar bis

Stahldeckel
Schachtverlängerungen (nur für Einsatz begehbar)
Durch das neue Domschachtsystem bilden Schachtrahmen mit Deckel eine 100 % bündige Anpassung an das Gelände. Die Tankabdeckung sitzt nahezu fugenlos auf dem Schachtrahmen und verhindert das Schmutz eindringt. Stufenlose Höhenanpassung durch einfaches Zusägen.
 Schachtverlängerung VS 20:
Schachtverlängerung VS 20:
Höhe 25 cm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 20 cm
Schachtverlängerung VS 60:
Höhe 63,5 cm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 60 cm
Zwischenring: Zur Verlängerung der VS 20/VS 60
Höhe 600 mm, Ø 60 cm

Pakete Befahrbarkeit (nur zusammen mit einer Komplettanlage bestellbar)
Aufpreis PKW-Befahrbarkeit max. Achslast 2,2 t, Lieferumfang:
Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60, Zwischenring
zur Lastentkopplung (statt VS 60 / TopCover)

Vorbereitung LKW-Befahrbarkeit
(Belastungsklasse SLW 30), max. Achslast 11,5 t, bestehend aus:
Zwischenring(e), Höhe 60 cm, zusätzlich bauseits Rahmen und Abdeckung
Klasse D stellen (statt VS 60/ TopCover)
 Auftriebssicherung
Auftriebssicherung
Gittergewebe zur Auftriebsicherung für Klärbehälter Monolith (alle Größen) in Gebieten mit hohem Grundwasserstand
Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:
SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube
SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube
SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.
SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern
SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube
SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube
Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube
Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube
Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube
Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage
Biologische Klärschlamm-Entsorgung
Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube
Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube
Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen
Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen
Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube
Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen
Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen
Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe
Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen
Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen
Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen
Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen
.Entsorgung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen in Schleswig-Holstein
5.1 Verwertung
Die landwirtschaftliche Verwertung, auf die in Kapitel 6 noch näher eingegangen wird, stellt in Schleswig-Holstein die dominierende Entsorgung kommunaler Klärschlämme dar. So werden regelmäßig annähernd 50 % der insgesamt angefallenen Klärschlämme landwirtschaftlich verwertet (vgl. Tabelle 6). Als Sonderfall muß die kommunale Kläranlage Glückstadt-Süd (Kreis Steinburg) herausgestellt werden, deren Klärschlammaufkommen fast ausschließlich aus der Behandlung gewerblicher Abwässer (Papierindustrie) entsteht. Auf Grund der Tatsache, dass die Entsorgung dieser Menge geregelt ist, erfasst der Abfallwirtschaftsteilplan Klärschlamm diese Menge nicht. Unter Abzug dieser Mengen ist festzustellen, dass von den restlichen Mengen in den Jahren 1993-1997 im Mittel 83 % der kommunalen Klärschlämme landwirtschaftlich verwertet wurden.
Tabelle 6: Klärschlammentsorgung in Schleswig-Holstein 1993 - 1997 (in Mg TS)
1) anschließende landwirtschaftliche Verwertung (ohne Kalk)
2) bis auf 7,5 Mg im Jahre 1997 ausschließlich Kläranlage Glückstadt Süd
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):
Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins
für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Im Rahmen der Datenerhebung zum Abfallwirtschaftsteilplan Klärschlamm wurde offensichtlich, dass die Nachfrage nach Klärschlamm regional zurzeit höher ist als das Angebot. Aus dem gleichbleibend guten Absatzmarkt der letzten Jahre ist zu schließen, dass die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm auch in Zukunft ein wichtiger Verwertungsweg bleiben wird.
Die der Klärschlammkompostierung zugeführten Klärschlämme wurden anschließend zu 100 % landwirtschaftlich verwertet. In Schleswig-Holstein ist z.Zt. eine Klärschlammkompostierungsanlage in Schönberg (Kreis Plön) bekannt, in der 1997 369,0 Mg TS Klärschlamm (vgl. Tabelle 7) behandelt und anschließend komplett in der Landwirtschaft verwertet wurden.
Eine Verwertung von Klärschlamm in der Rekultivierung erfolgt in Schleswig-Holstein selbst z.Zt. nicht; Klärschlämme aus Schleswig-Holstein wurden in den letzten Jahren jedoch zunehmend bei Rekultivierungsmaßnahmen, insbesondere in den neuen Bundesländern eingesetzt: So wurden 1997 13.797,1 Mg TS der in Schleswig-Holstein erzeugten Klärschlämme außerhalb des Landes im Rekultivierungsbereich verwertet, 13.424,5 Mg TS davon in den neuen Bundesländern (vgl. Tabelle 7).
In den Jahren 1993-1997 wurden im Mittel 7,5 % der kommunalen Klärschlämme (ohne Glückstadt-Süd) in Kompostierungsanlagen behandelt bzw. bei Rekultivierungsmaßnahmen verwertet.
Anlagen zur Vererdung von Klärschlämmen waren in Schleswig-Holstein bis zum Erhebungsjahr 1997 nicht in Betrieb.
Gem. § 4 KrW-/AbfG ist bei der thermischen Entsorgung von Klärschlamm dem Hauptzweck der Maßnahme folgend zwischen der energetischen Verwertung einerseits und der Beseitigung durch Verbrennung andererseits zu unterscheiden.
Im Jahr 1997 wurden insgesamt 49.207,5 Mg TS der in Schleswig Holstein angefallenen Klärschlämme energetisch verwertet. Von dieser Menge wurden allein 49.200 Mg TS von der Kläranlage Glückstadt-Süd (Schlämme aus der Papierindustrie) verwertet (vgl. Tabelle 7). Wie bereits dargestellt setzt sich diese Menge fast auschließlich aus nicht kommunalen Klärschlämmen zusammen und wird vom Abfallwirtschaftsteilplan Klärschlamm nicht erfasst. Über die genannten Mengen hinaus wurden 1997 7,5 Mg TS der Klärschlämme der Kläranlage Hetlingen zur energetischen Verwertung nach Niedersachsen exportiert (vgl. Tabelle 7).
Tabelle 7: Differenzierte Darstellung der Klärschlammentsorgung in Schleswig-Holstein 1997 (in Mg TS)
Quelle:Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999): Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins
für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
5.2 Beseitigung
Die Beseitigung nicht verwertbarer Klärschlämme kann durch Ablagerung auf Deponien oder durch Verbrennung erfolgen. In den letzten Jahren wurden in Schleswig-Holstein durchschnittlich 10 % der kommunalen Klärschlämme (ohne Glückstadt-Süd) auf diese Weise beseitigt.
Die Ablagerung auf Deponien ist nur für solche Klärschlämme erlaubt, die nicht verwertet werden können.
Des Weiteren ist zu beachten, dass gemäß Ziffer 12.1 der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi) 15 eine Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungswerte nach Anhang B nicht einhalten, bis zum 01. Juni 2005 nur aus Gründen mangelnder Behandlungskapazitäten und ab dem 01. Juni 2005 nicht mehr zulässig ist. Da unbehandelte Klärschlämme insbesondere die Zuordnungswerte für den organischen Anteil des Trockenrückenstandes der Originalsubstanz (TASi Anhang B Nr. 2) nicht einhalten können, wird ab diesem Zeitpunkt die Ablagerung von Klärschlämmen auf Deponien ohne eine vorherige Behandlung nicht mehr möglich sein.
Im Jahr 1997 wurden in Schleswig-Holstein 1.680,1 Mg TS Klärschlamm durch Ablagerung auf Deponien beseitigt: So wurden vom Kreis Dithmarschen 400,7 Mg TS und vom Kreis Steinburg 456,4 Mg TS auf der Deponie Ecklack (Kreis Dithmarschen) sowie vom Kreis Segeberg 823,0 Mg TS auf der Deponie Damsdorf (Kreis Segeberg) abgelagert (vgl. Tabelle 7).
Eine Verbrennung von Klärschlamm kann einerseits in separaten Klärschlammverbrennungsanlagen erfolgen, andererseits ist eine Mitverbrennung z.B. in Kohlekraftwerken oder Müllverbrennungsanlagen möglich. In Schleswig-Holstein selbst wurde im Erhebungsjahr 1997 keine Beseitigung von kommunalem Klärschlamm durch Verbrennung vorgenommen.
15 Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zum AbfG: Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen (TA Siedlungsabfall - TASi) vom 14. Mai 1993 ( BAnz. Nr. 99 a)
6 Landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm
6.1 Einsatz von Klärschlamm als Sekundärrohstoffdünger
Auf Grund der Bedeutung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm in Schleswig-Holstein sollen die Ziele und Grundsätze dieses Verwertungsweges im Folgenden näher betrachtet werden.
Der Einsatz von Klärschlamm als Sekundärrohstoffdünger in der Landwirtschaft ist auf Grund
des Gehaltes an Pflanzennährstoffen (N, P,K und weitere Mineralien),
des Gehaltes an organischer Substanz und
der insgesamt bodenverbessernden Eigenschaften (dazu zählen z.B. ein höheres Wasserrückhaltevermögen, ein höherer Gehalt an Biomasse sowie ein höherer Kalkgehalt)
grundsätzlich sinnvoll.
Der Gedanke der Rückführung der im Klärschlamm enthaltenen Nähr- und Humusstoffe in den Naturkreislauf weist zudem folgende Vorteile auf:
· Durch Einsparung von Deponieraum und Ersatz von Mineraldünger werden wertvolle Ressourcen geschont.
· Der Einsatz von Klärschlamm in der Landwirtschaft leistet über die Düngewirkung hinaus einen Beitrag zur CO2-Minderung, da der Mineraldüngereinsatz insbesondere für die Pflanzennährstoffe Kalk und Phosphat reduziert werden kann.
Kritiker der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung befürchten indes, dass mit der Klärschlammaufbringung eine Schadstoffanreicherung im Boden einhergeht. Klärschlämme, die die von der AbfKlärV vorgegebenen Grenzwerte ausschöpfen, werden vor dem Hintergrund des Schutzes der Ressource Boden als Risiko für die Landwirtschaft angesehen. Zudem wird vor der Unterschätzung unbekannter Verbindungen gewarnt. Der vorgeschriebene Umfang der durch die AbfKlärV vorgegebenen Untersuchungen wird insgesamt als unzureichend angesehen. Hinsichtlich der Bodengrenzwerte wird befürchtet, dass das Restrisiko mit der Verfeinerung der Analysenmethodik steigt. Von den Kritikern der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung werden außerdem die eingeschränkte Nutzungsfähigkeit der Böden, z.B. für die Umstellung auf ökologischen Landbau sowie mögliche Wertverluste bei der Veräußerung bzw. Verpachtung der Flächen nach der Klärschlammbeschickung angeführt. Ökolandbauverbände schließen in ihren jeweiligen Anbaurichtlinien den Einsatz von Klärschlamm aus. Dies gilt für alle Anbauflächen, wobei es unerheblich ist, ob dort Nahrungs‑
oder Futtermittel angebaut werden. Die Verbände arbeiten überwiegend mit so genannten Positivlisten für die Stoffe, die als Dünger eingesetzt werden dürfen. Deshalb wird der Einsatz von Klärschlamm in den meisten Fällen nicht ausdrücklich verboten, sondern durch die „Nichtnennung“ ausgeschlossen.
Die Aufnahme von ausschließenden Klärschlammklauseln in die Lieferverträge zwischen Landwirten und Getreidemühlen ist dagegen in den letzten Jahren bundesweit rückläufig. Dies ist in erster Linie auf Gespräche des Bundesumweltministeriums (BMU) mit Vertretern der Ernährungsindustrie, der Landwirtschaft und der kommunalen Spitzenverbände im März 1996 zurückzuführen, in denen einvernehmlich festgestellt wurde, dass „Behinderungen wie z.B. Aufbringungsverbote von Getreidemühlen für Getreidebau-Vertragsflächen oder Werbeinhalte, die darauf hinweisen, dass bei der Erzeugung der genannten Produkte kein Klärschlamm eingesetzt worden ist, nicht nur das von der Bundesregierung verfolgte Ziel der Kreislaufwirtschaft gefährden, sondern auch ungerechtfertigt sind“. Gleichwohl gibt es Erzeugergemeinschaften zur Herstellung von Brotgetreide, die den Einsatz von Klärschlamm nach wie vor ausschließen.
Vor dem Hintergrund eines vorsorgeorientierten Bodenschutzes hat die Landesregierung Schleswig-Holsteins die Kritik bezüglich einer durch Klärschlämme verursachten Schadstoffanreicherung im Boden in den Abwägungsprozess zur Umsetzung der Pflichtenhierarchie des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes einbezogen. Die geringe Schadstoffbelastung schleswig-holsteinischer Klärschlämme und die umfangreichen Erfahrungen im Umgang mit Klärschlamm bilden eine gesicherte Grundlage für den eingeschlagenen Verwertungsweg. Im Hinblick auf die Novellierung bundesgesetzlicher Vorschriften wird sich Schleswig-Holstein darüber hinaus für eine Absenkung der nach AbfKlärV zulässigen Schadstoffgehalte und eine Harmonisierung mit den bodenschutzgesetzlichen Vorschriften einsetzen. Maßstab für diese Änderungen soll dabei die Empfehlung des „Eckernförder Arbeitskreies zur Klärschlammverwertung in der Landwirtschaft“, auf die im Folgenden näher eingegangen wird, sein.
6.2 Referenzwerte
Die mit der AbfKlärV vom Bundesgesetzgeber festgelegten Grenzwerte, die eine schadlose Verwertung von Klärschlamm in der Landwirtschaft sicherstellen sollen, werden teilweise kontrovers diskutiert. Insbesondere wird befürchtet, dass bei Auslastung der Grenzwerte (Höchstmengen) eine ausgeglichene Schadstoffbilanz nicht gewährleistet werden kann.
In einem vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) geförderten Verbundvorhaben wurden die Wirkungen eines langjährigen Aufbringens von Klärschlamm auf Böden unter Nahrungs- und Futterpflanzen untersucht. Dabei wurden insbesondere die Schwermetallgehalte und -bindungsformen im Boden, die Schwermetallaufnahme durch Kulturpflanzen, die Leistung und Artenvielfalt der Bodenmikroorganismen und Artenvielfalt bzw. Individuendichte von Bodentieren betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Klärschlamm auf Böden mit landwirtschaftlicher Nutzung im Rahmen harmonisierter rechtlicher Regelungen aus Sicht des Bodenschutzes vorstellbar ist.
Um dennoch einer langfristigen Anreicherung von Schadstoffen im Boden vorzubeugen, sei es sinnvoll, die Grenzwerte der AbfKlärV zu reduzieren. Des Weiteren wird in dem Forschungsbericht empfohlen, die Grenzwerte im Klärschlamm möglichst nur zu 50 % auszunutzen.
Um dieser Diskussion, die auch in Schleswig-Holstein geführt wurde, Rechnung tragen zu können, hat die Arbeitsgruppe “Klärschlammverwertung in der Landwirtschaft“, die sich aus Vertretern des Umweltministeriums, des Landwirtschaftsministeriums, der Landwirtschaftskammer, des Kreises Rendsburg-Eckernförde, der Stadt Eckernförde sowie des Toxikologischen Institutes der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eine Empfehlung zur landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm erarbeitet. Der so genannte „Eckernförder Arbeitskreis“ empfiehlt für Schleswig-Holstein über die Anforderungen der in Kap. 3.2 dargestellten rechtlichen Grundlagen hinaus die Einhaltung der in den nachfolgenden Tabellen genannten Referenzwerte für Schadstoffe in Böden und Klärschlämmen.
Die genannten Referenzwerte besitzen nur empfehlenden Charakter. Den ordnungsrechtlichen Rahmen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung gibt auch weiterhin die AbfKlärV des Bundes vor.
Mit der AbfKlärV sind für Klärschlämme, die landwirtschaftlich verwertet werden sollen, ma‑
ximal zulässige Schadstoffgehalte festgelegt worden. In der folgenden Tabelle 8 sind die
vom „Eckernförder Arbeitskreis“ empfohlenen Referenzwerte für Klärschlamm den gesetzlich festgelegten Werten der AbfKlärV gegenübergestellt.
Tabelle 8: Vergleich der Grenzwerte der AbfKlärV (Klärschlamm)
mit den Referenzwerten für Klärschlamm
1) gem. § 4 Abs. 12 AbfKlärV
2) bodenartspezifisch abweichende Werte
3) bei geogen höher bedingten Werten: 50 mg/kg
4) Referenzwert gilt nicht, wenn ein entsprechender Düngerbedarf vorliegt
5) abschließende Bewertung folgt; Angaben für PCB zukünftig in TE
6) zukünftig werden Werte zwischen 10 und 20 ng TE/kg angestrebt
7) TE=Toxizitäts-Äquivalent der Dioxine und Furane, berechnet nach NATO-CCMS
8) Wegen der besonderen Toxizität von Cadmium sind niedrigere Werte anzustreben
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):
Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins
für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Darüber hinaus sind in der AbfKlärV Belastungsgrenzwerte für den Boden festgelegt. Mindestens vor der ersten Beschlammung und danach regelmäßig alle 10 Jahre müssen die Böden untersucht werden. In der folgenden Tabelle 9 sind die vom „Eckernförder Arbeitskreis“ empfohlenen Referenzwerte für Böden den gesetzlich festgelegten Werten der AbfKlärV gegenübergestellt.
Tabelle 9: Vergleich der Grenzwerte der AbfKlärV (Böden)
mit den Referenzwerten für Boden
1) gem. § 4 Abs. 8 AbfKlärV
2) bodenartspezifisch abweichende Werte
3) bei geogen höher bedingten Werten: 50 mg/kg
4) Referenzwert gilt nicht, wenn ein entspr. Düngerbedarf vorliegt
5) abschließende Bewertung folgt; Angaben für PCB zukünftig in TE
7) TE = Toxizitäts-Aquivalent der Dioxine und Furane, berechnet nach NATO-CCMS
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):
Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins
für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Die dargestellten Referenzwerte schöpfen die von der AbfKlärV vorgegebenen Grenzwerte nur zu 30 % bis 50 % aus und bieten damit über den gesetzlichen Rahmen hinaus eine zusätzliche Sicherheit für den Produzenten landwirtschaftlicher Produkte, Konsumenten sowie im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes.
Der nachfolgenden Auswertung (vgl. Tabelle 10) ist zu entnehmen, dass die im Erhebungszeitraum untersuchten Klärschlämme die Referenzwerte des „Eckernförder Arbeitskreises“ im Mittel zu 34,0 % ausgenutzt haben. Dabei war im genannten Zeitraum nur für die Parameter AOX (71,5 %), Cadmium (38,8/29,1 %), Quecksilber (49,6) und Zink (58,3 %) eine prozentuale Ausnutzung der Referenzwerte von > 25 % zu verzeichnen. Die maximale Ausnutzung der Referenzwerte war für Kupfer (95,9%) zu verzeichnen.
Teilplan Klärschlamm 2000-2010
Tabelle 10: Ausnutzung der Referenzwerte des „Eckernförder Arbeitskreises“ (Klärschlamm) (1993-1997)
1) gem. § 4 Abs. 12 AbfKlärV Die Statistik enthält die Mittelwerte aller Untersuchungsproben der LUFA-Kiel einschließlich aller eventuellen Mehrfachuntersuchungen
2)gesamt als TE eines Klärwerkes, unabhängig davon, ob die Schlämme landwirtschaftlich verwertet werden.
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999): Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins
für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Teilplan Klärschlamm 2000-2010
Die folgende Abbildung 1 stellt die Ausnutzung der Grenzwerte der AbfKlärV bzw. der Referenzwerte durch die Jahresmittelwerte der Klärschlammqualitäten vergleichend dar:
Abbildung 1: Vergleich der Ausnutzung der Grenzwerte der AbfKlärV (Klärschlamm) und der Ausnutzung der Referenzwerte des „Eckernförder Arbeitskreises“ (Klärschlamm) durch die Jahresmittelwerte der Klärschlammqualitäten (1993-1997)
Quelle: Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten (MUNF) 2000
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die in Schleswig-Holstein produzierten kommunalen Klärschlämme auch unter Zugrundelegung der strengen Maßstäbe des „Eckernförder Arbeitskreises“ eine geringe Schadstoffbelastung aufweisen.
6.3 Nachweisverfahren
Die AbfKlärV beinhaltet weiterhin umfangreiche Nachweis- und Dokumentationspflichten (vgl. insbesondere die Nachweispflichten gem. § 7 AbfKlärV sowie den Aufbringungsplan gem. § 8 AbfKlärV), um eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.
Die Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung in Schleswig-Holstein
obliegt den Landräten oder Bürgermeistern der Kreise und kreisfreien Städte. Landwirt‑
6. Landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm
schaftliche Fachbehörde ist die LUFA Kiel. Jede beabsichtigte Ausbringung ist mindestens 14 Tage vorher bei der jeweils zuständigen Überwachungsbehörde und der landwirtschaftlichen Fachbehörde anzumelden. Die zentrale Erfassung der Klärschlammverwertung (Klärschlammkataster) anhand der Lieferscheine wird von der landwirtschaftlichen Fachbehörde durchgeführt. Dabei werden gleichzeitig die wesentlichen Vorschriften zu Ausbringungsmengen, Ausbringungsfristen und Schadstofffrachten und - so weit es die Datenlage zulässt - die Einhaltung der düngemittelrechtlichen Vorschriften über die zulässigen Nährstofffrachten überprüft. Gegebenenfalls erfolgt über die zuständige Überwachungsbehörde im Einvernehmen mit der landwirtschaftlichen Fachbehörde eine Auflage, Einschränkung oder Untersagung der Ausbringung. Die abschließende Überprüfung von Düngebilanzen gemäß Düngeverordnung obliegt den Ämtern für ländliche Räume. Von den Nachweispflichten nach § 7 der AbfKlärV ausgenommen sind die Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen zur Behandlung von Haushaltsabwässern oder Abwässern mit ähnlich geringer Schadstoffbelastung und Anlagen mit einer Ausbaugröße kleiner 1.000 EW (Größenklasse 1), d.h. sie sind nicht gezwungen, am Lieferscheinverfahren teilzunehmen. Von der Untersuchungspflicht vor Ausbringung sind diese Anlagen jedoch nicht ausgenommen, daher sollten auch hierzu den Überwachungsbehörden Daten vorliegen. Insgesamt ist der Anteil von Schlämmen aus Kläranlagen kleiner 1.000 EW an der Gesamtmenge des erzeugten Klärschlammes in Schleswig-Holsteins mit etwas unter 20% anzusetzen.
Das in Schleswig-Holstein im Auftrag der Landesregierung praktizierte Nachweis- und Dokumentationsverfahren über die durchgeführten Klärschlammaufbringungen stellt sicher, dass keine Doppelbeschlammungen, Frachtüberschreitungen, Grenzwertüberschreitungen sowie andere Verstöße gegen die AbfKlärV stattfinden. Diese Verfahrensweise bietet somit ein Höchstmaß an Sicherheit für Landwirte und Klärwerksbetreiber, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Bodenschutzes.
KKN-Umwelttechnik liefert in die nachfolgenden Gebiete frei Haus. Selbstverständlich führen wir in den unten angegebenen Kreisen, Gemeinden und Städten auch für die Anlagen Einbau- und Einrichtungsarbeiten durch. Außerdem übernehmen wir für unsere SBR-Kleinkläranlagen auch gern die gesetzlich vorgeschriebene Wartung.
Kunststoff Klärgrube PE-Sammelgrube Online kaufen Siek
SBR-Kläranlagen Online kaufen und sparen Stemwarde
Kreis Steinburg SBR-Wirbelbett-Festbett-Kläranlage
SBR-Kläranlage Trittau