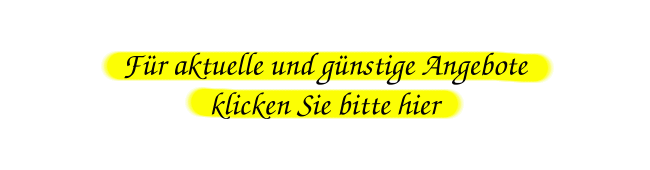- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank
- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube
- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung
- Pflanzenkläranlagen nach DWA
- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben
- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben
- Regenwasser-Zisterne Beton
- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff
- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung
- Wartung Dichtheitsprüfung
- Baden-Württemberg 07903 4060645
- Hamburg 040 29850918
- Niedersachsen 05199 9983960
- Sachsen 034298 480500
(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)
Versickerungssystem KLAR-BOX
Sickersystem KLAR-BOX (Sickergraben angelehnt an DIN 4261)
VORTEILE:- einfacher Einbau durch geringes Gewicht und geringe Einbautiefe
- Kosten sparende Eigenleistungen beim Einbau möglich
- höchste Sicherheit durch Volumen und Spülbarkeit


|
Anzahl benötigter KLAR-BOXEN (Einzelteile) nach DIN 4261-1: |
|
| gut sickerfähiger Boden | Boxen pro 2 Einwohner | |
| mäßig sickerfähiger Boden | 6 Boxen pro 2 Einwohner | |
Listenpreise für diese Anlagentypen:
|
Artikel |
Sickersystem - Beschreibung |
€ Preis* |
| SiKl-6 | Sickerpaket KLAR-BOX 6 6 Stück Sickerboxen aus Polypropylen (insgesamt 360 x 40 x 60 cm) mit Vlies, 5 m Vollsickerrohr, Kontrollschacht DN 200, Be- und Entlüfter |
448,-
|
| SiKl-18 | Sickerpaket KLAR-BOX 18 18 Stück Sickerboxen aus Polypropylen (insgesamt 540 x 40 x 60 cm) mit Vlies, 5 m Vollsickerrohr, Kontrollschacht DN 200, Abzweig DN 100, Be- und Entlüfter |
998,-
|
| SieKlEr-6 | Erweiterungspaket KLAR-BOX 6 6 Stück Sickerboxen aus Polypropylen (insgesamt 360 x 40 x 60 cm) mit Vlies, 5 m Vollsickerrohr |
348,-
|
| SieKlEr-1 | KLAR-BOX Einzelteil zur Erweiterung 60 x 40 x 60 cm, 144 l, ca. 4 kg |
58-
|
| SiRo | Vollsickerrohr 5 m |
34,-
|
| SiVl | Vlies für KLAR-BOX (für 6 Boxen) |
16,-
|
Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:
SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube
SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube
SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.
SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern
SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube
SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube
Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube
Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube
Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube
Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage
Biologische Klärschlamm-Entsorgung
Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube
Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube
Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen
Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen
Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube
Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen
Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen
Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe
Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen
Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen
Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen
Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen
Klärschlamm
Die Erarbeitung von Abfallwirtschaftsplänen durch die zuständigen Behörden ist eine im EU-Recht verankerte Pflichtaufgabe der EU-Mitgliedstaaten, die durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) 1 auf die Länder übertragen wurde. Der Abfallwirtschaftsteilplan Klärschlamm bildet gemeinsam mit den Abfallwirtschaftsteilplänen Bauabfall und Siedlungsabfall sowie dem Teilplan für Abfälle aus dem industriellen und gewerblichen Bereich den Abfallwirtschaftsplan der Länder.
Auf der Grundlage einer Darstellung der aktuellen Situation und künftig zu erwartender Klärschlammmengen aus kommunalen Kläranlagen werden die Perspektiven der Entsorgung und der daraus resultierende Handlungsbedarf aufgezeigt. Der Abfallwirtschaftsteilplan Klärschlamm stellt die Planungsgrundlage für die Klärschlammentsorgung innerhalb des Planungszeitraumes von 2000 bis zum Jahr 2010 dar. Er basiert auf Datenbeständen aus den Jahren 1993 bis 1997. Daten für das Jahr 1998 lagen zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht vor.
Zielgruppen des Abfallwirtschaftsteilplans Klärschlamm sind
· die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die - so weit die Klärschlamme nicht von der Entsorgungspflicht ausgeschlossen worden sind - die umweltverträgliche Entsorgung der Klärschlämme sicherzustellen haben,
· die Kläranlagenbetreiber,
· Eigentümer von Flächen, auf denen eine Klärschlammverwertung möglich ist sowie
· Betreiber von Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsanlagen für Klärschlämme.
Rechtlicher Rahmen
Abfall-Rahmenrichtlinie der Europäischen Union
Gemäß Artikel 7 der Abfall-Rahmenrichtlinie 2 hat die Europäische Union (EU) die zuständigen Behörden ihrer Mitgliedstaaten verpflichtet, Abfallbewirtschaftungspläne zu erstellen. Sie umfassen insbesondere
1 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455).
Richtlinie des Rates (91/156/EWG) vom 18. März 1991 zur Änderung der Richtlinie 75/442/EWG über Abfälle (Abfall-Rahmenrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 78 S. 32 vom 26. März 1991).
Art, Menge und Ursprung der zu verwertenden oder zu beseitigenden Abfälle, allgemeine technische Vorschriften,
besondere Vorkehrungen für bestimmte Abfälle,
geeignete Flächen für Deponien und sonstige Beseitigungsanlagen.
Die Pläne sind der EU-Kommission zu übermitteln.
1.2.2 Klärschlammrichtlinie der Europäischen Union
In der EU-Klärschlammrichtlinie3 von 1986 sind die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung festgelegt. Zur Umsetzung dieser Richtlinie wurde die Klärschlammverordnung (AbfKlärV) erlassen. Derzeit liegt der Vor-Entwurf einer neuen EG-Klärschlammrichtlinie (3.Entwurf vom 27.04.00) vor. Darin ist vorgesehen, den Anwendungsbereich für die Klärschlammverwertung auszuweiten und die Frachtgrenzwerte der Schadstoffe in zwei Schritten (mittelfristig bis 2015 und langfristig bis 2025) abzusenken. Nach dem vorliegenden Entwurf liegen jedoch die zulässigen Frachten auch mittelfristig noch deutlich über nach der AbfKlärV derzeit zulässigen. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht haben die Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit höhere Anforderungen festzulegen.
1.2.3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Mit § 29 KrW-/AbfG wird die in der EU-Rahmenrichtlinie enthaltene Verpflichtung zur Abfallwirtschaftsplanung in nationales Recht umgesetzt. Danach sind die Bundesländer verpflichtet, für ihren Bereich Abfallwirtschaftspläne nach überörtlichen Gesichtspunkten aufzustellen. Gem. § 29 Abs. 1 KrW-/AbfG stellen die Abfallwirtschaftspläne
1. die Ziele der Abfallvermeidung und Abfallverwertung sowie
2. die zur Sicherung der Inlandsbeseitigung erforderlichen Abfallbeseitigungsanlagen dar
und weisen
1. zugelassene Abfallbeseitigungsanlagen und
2. geeignete Flächen für Abfallbeseitigungsanlagen aus.
Die Pläne können ferner bestimmen, welcher Abfallbeseitigungsanlage sich die Beseiti‑
gungspflichtigen zu bedienen haben. Diese Ausweisungen können für die Beseitigungs‑
pflichtigen für verbindlich erklärt werden. Bei der Darstellung des Bedarfs an Abfallentsor‑
3 Richtlinie des Rates (86/278/EWG) vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft (Abl. Nr. L181, S. 6)
gungsanlagen sind zukünftige, innerhalb eines Zeitraumes von mindestens 10 Jahren zu erwartende Entwicklungen zu berücksichtigen (§ 29 Abs.2 Satz 1 KrW-/AbfG).
1.2.4 Landesabfallwirtschaftsgesetz
Gemäß § 8 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) 4 erstellt die oberste Abfallbehörde in Abstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern den Abfallwirtschaftsplan, der auch in sachlichen und räumlichen Teilabschnitten (Teilplänen) aufgestellt werden kann. Entsprechend den in § 29 KrW-/AbfG definierten Vorgaben werden innerhalb des vorliegenden Abfallwirtschaftsteilplanes Klärschlamm die Ziele der Klärschlammverwertung formuliert und die zur Sicherung der Inlandbeseitigung erforderlichen Beseitigungskapazitäten dargestellt.
4 Abfallwirtschaftsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz - LAbfWG) in der Fassung vom 18. Januar 1999 (GVOBl. Schl.-H. 1999, S. 27)
2. Abfallwirtschaftliche Ziele der Klärschlammentsorgung
Der globale und langfristige Ansatz des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung beinhaltet vor dem Hintergrund endlicher Ressourcen und der begrenzten Belastbarkeit unserer Biosphäre einen weitsichtigen Umgang mit Stoffen.
Nicht erneuerbare Energieträger und sonstige Rohstoffe stehen ebenso wie die Ressourcen Wasser und Boden nicht unbegrenzt zur Verfügung. Aus diesem Grund ist die effiziente Nutzung von Ressourcen, das Schließen von Stoffkreisläufen und eine nachhaltige Entwicklung der Konsumstrukturen notwendig. Die zentralen Grundsätze der Nachhaltigkeit finden sich u. a. auch im KrW-/AbfG wieder.
Für Klärschlamm als Abfall i. S. des § 3 Abs. 3 Nr.1 KrW-/AbfG gilt die in den „Grundsätzen und Pflichten der Erzeuger und Besitzer von Abfällen sowie der Entsorgungsträger“ des KrW-/AbfG verankerte abfallwirtschaftliche Hierarchie:
1. Vermeidung
2. Verwertung
3. Beseitigung
Auf Grund der Tatsache, dass eine Vermeidung von Klärschlamm praktisch nicht möglich ist, weil das Aufkommen an Klärschlamm mit den stetig wachsenden Bemühungen um den Gewässerschutz korrespondiert, ist die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) von Klärschlamm sicherzustellen. Parallel dazu sind insbesondere technische Möglichkeiten, die eine Verminderung des Klärschlammaufkommens bewirken können, zu berücksichtigen.
Klärschlamm eignet sich wegen seines Gehaltes an organischer Substanz und Pflanzennährstoffen bei ordnungsgemäßer Anwendung grundsätzlich zur landwirtschaftlichen Verwertung, insbesondere zur Düngung sowie Verbesserung und Erhaltung der Bodenstruktur. Trotz der hohen Anforderungen an Analytik, Düngeplanung, Nachweisführung und Dokumentation, die sich aus den Anforderungen der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 5 ergeben, stellt die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm zudem eine kostengünstige Form der Klärschlammentsorgung dar.
Vor diesem Hintergrund ist es vorrangiges Ziel der Landesregierung, die in Schleswig-Holstein anfallenden Klärschlämme unter Einhaltung der Anforderungen der in Kapitel 3.2 dargestellten rechtlichen Grundlagen als Sekundärrohstoffdünger landwirtschaftlich zu verwerten.
5 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), geändert durch Verordnung vom 06. März 1997 (BGBl. I S. 446).
2. Abfallwirtschaftliche Ziele der Klärschlammentsorgung
Über die Anforderungen der AbfKlärV hinaus finden die von der Arbeitsgruppe „Klärschlammverwertung in der Landwirtschaft (Eckernförder Arbeitskreis)“ für Schleswig-Holstein erarbeiteten Referenzwerte für Schadstoffe in Klärschlämmen und Böden Beachtung. Der Einführung der Referenzwerte liegt der Gedanke zu Grunde, den schadstoffseitigen Eintrag in den Boden weitgehend zu minimieren, so dass auch auf lange Sicht eine Anreicherung von organischen und anorganischen Schadstoffen vermieden wird. Auf diese Weise kommt man dem Ziel näher, eine ausgeglichene Balance zwischen Schadstoffeintrag und umweltverträglichem Schadstoffaustrag zu erzielen und die Qualität unserer Böden auch auf lange Sicht zu erhalten.
Die Referenzwerte schöpfen die von der AbfKlärV vorgegebenen gesetzlichen Grenzwerte nur zu 30 % bis 50 % aus (vgl. Tab. 8 und 9) und bieten damit über den gesetzlichen Rahmen hinaus eine zusätzliche Sicherheit für Produzenten landwirtschaftlicher Produkte, Verbraucher sowie vor dem Hintergrund des Bodenschutzes. Die genannten Referenzwerte besitzen nur empfehlenden Charakter. Den ordnungsrechtlichen Rahmen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung gibt auch weiterhin die AbfKlärV des Bundes vor.
Klärschlamm, der nicht in den Anwendungsbereich der AbfKlärV fällt oder die darin festgelegten Anforderungen nicht erfüllt, darf landwirtschaftlich nicht verwertet werden. Landwirtschaftlich oder anderweitig nicht zu verwertender Klärschlamm muss entsprechend den Vorgaben des KrW-/AbfG umweltverträglich beseitigt werden. Die möglichen Verfahren der Klärschlammbeseitigung sind in Anhang II A des KrW-/AbfG zusammengefasst. Die Landesregierung fördert die Technologie für die Verwertung von Biomasse, insbesondere landwirtschaftlich nicht verwertbarer Klärschlämme mit dem Ziel, einen möglichst hohen Anteil des Klärschlammaufkommens für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Damit kann auch der Anteil zu beseitigender Klärschlämme reduziert werden.
.
3. Grundlagen der Klärschlammentsorgung
3.1 Definition
Klärschlamm ist gemäß § 2 Abs. 2 AbfKlärV der bei der Behandlung von Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen einschließlich zugehöriger Anlagen zur weitergehenden Abwasserreinigung anfallende Schlamm, auch entwässert oder getrocknet oder in sonstiger Form behandelt. Auch der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm sowie Klärschlammkomposte und Klärschlammgemische gelten als Klärschlamm im Sinne der AbfKlärV.
3.2 Rechtliche Grundlagen
Klärschlämme unterliegen als Abfall im Sinne des § 3 Abs. 3 Nr. 1 KrW-/AbfG den Bestimmungen des KrW-/AbfG und sind gem. § 4 KrW-/AbfG einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder gemeinwohlverträglichen Beseitigung zuzuführen. Gemäß der Anlage zu § 1 der Verordnung zur Bestimmung von überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung (BestüVAbfV) 6 handelt es sich bei Klärschlamm im Grundsatz um einen überwachungsbedürftigen Abfall zur Verwertung (EAK-Schlüssel: 19 08 05).
Gesetzliche Grundlage für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm in der Bundesrepublik Deutschland ist die auf Grund des § 15 Abs. 2 des Abfallgesetzes (AbfG) 7 erlassene Klärschlammverordnung (AbfKlärV). Sie regelt unter anderem die Voraussetzungen für das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden (Bodenuntersuchungen, Klärschlammuntersuchungen), enthält Aufbringungsverbote und -beschränkungen, bestimmt die Aufbringungsmenge und legt Nachweispflichten fest.
In § 1 Abs. 2 AbfKlärV wird ausdrücklich bestimmt, dass die Vorschriften des Düngemittel-rechts unberührt bleiben. Nach dem Düngemittelgesetz 8, zählt Klärschlamm zu den Sekundärrohstoffdüngern und ist somit ein Düngemittel. Dadurch unterliegt die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung auch düngemittelrechtlichen Regelungen.
Klärschlämme, die den Anforderungen der AbfKlärV entsprechen, unterliegen bei der land‑
wirtschaftlichen Verwertung zudem den Anforderungen der Verordnung über die Grund‑
6 Verordnung zur Bestimmung von überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung (BestüVAbfV) vom 10. September 1996 (BGBl. I S. 1377)
7 Abfallgesetzes (AbfG) vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 1410, 1501) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. August 1993, BGBl. I S. 1489).
8 Düngemittelgesetz vom 15. November 1977 (BGBl. I S. 2134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.September 1994 (BGBl. I S. 2705).
3. Grundlagen der Klärschlammentsorgung
sätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung) 9, sowie den Anforderungen der Durchführungsbestimmungen zur AbfKlärV 10.
Als Sekundärrohstoffdünger unterliegt Klärschlamm nach den Bestimmungen der Düngeverordnung u.a. den Grundsätzen der Düngebedarfsermittlung und den besonderen Grundsätzen für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft und Sekundärrohstoffdüngern. Die Klärschlammverwertung ist darüber hinaus in die Nährstoffvergleiche einzubeziehen und unterliegt den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.
Auf Grundlage des § 9 Düngemittelgesetz wurde ein Entschädigungsfonds eingerichtet, der die durch die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm eventuell entstehenden Schäden an Personen und Sachen sowie sich daraus ergebende Folgeschäden abdecken soll. Die Mitgliedschaft in diesem Entschädigungsfonds ist für Kläranlagenbetreiber, die Klärschlämme zur landwirtschaftlichen Verwertung abgeben, obligatorisch. Die Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung (KlärEV) 11 trat im Januar 1999 in Kraft. Die Verwaltung und Geschäftsführung des KlärEV erfolgt durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Bislang sind in Schleswig-Holstein durch die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung noch keine Schadensfälle und demzufolge keine Inanspruchnahme des Fonds angezeigt worden.
3.3 Zuständigkeiten
In Tabelle 1 sind die Funktionen und Zuständigkeiten der Behörden und Kläranlagenbetreiber bei der Durchführung der AbfKlärV in Schleswig-Holstein dargestellt:
9 Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung) vom 26. Januar 1996 (BGBl. I S. 118), geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung düngemittelrechtlicher Vorschriften vom 16. Juli 1997 (BGBl. I S. 1835)
10 Durchführungsbestimmungen zur Klärschlammverordnung (AbfKlärV) über die Verwertung von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden für Schleswig-Holstein, Bekanntmachung des Ministers für Natur und Umwelt vom 23. Januar 1996 - XI 540a/520a - 5270, 120-2-,(Amtsblatt für Schl.-H. 1996, S. 120).
11 Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung (KlärEV) vom 20. Mai 1998 (BGBl. I S. 1048).
Tabelle 1: Funktionen und Zuständigkeiten der Behörden und Kläranlagenbetreiber
bei der Durchführung der AbfKlärV in Schleswig-Holstein
1) Die vom LANU bestimmten Labore und Untersuchungsstellen für Boden- und Klärschlammuntersuchungen werden in einem Verzeichnis geführt und veröffentlicht.
2) Die Daten sind bis zum 31. August eines Folgejahres für das vorherige Kalenderjahr an das MUNF zu übermitteln.
3) Die landwirtschaftliche Fachbehörde ist gegenüber den UAB und den Klärschlammabnehmern nicht weisungsbefugt.
4) Die Auswertung wird dem MUNF bis spätestens zum 01. April des Folgejahres für das vorherige Kalenderjahr zur Verfügung gestellt. Das MUNF unterrichtet die UAB über die Ergebnisse der Klärschlammstatistik.
5) Das Register enthält Angaben über die erzeugten Schlammmengen und die an die Landwirtschaft gelieferten Schlammengen, die Eigenschaften der an die Landwirtschaft gelieferten Klärschlammmengen, die Art der Behandlung, die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen sowie die Bezeichnung der Aufbringungsfläche und die Adresse der Klärschlammempfänger. Die Daten sind von den Kläranlagenbetreibern bis zum 31. März des Folgejahres für das vorherige Kalenderjahr den UAB zuzuleiten.
Quelle: Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten (MUNF) (2000)
4. Aufkommen und Qualitäten des Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen in Schleswig-Holstein
4.1 Abwasserbeseitigung
In Schleswig-Holstein waren Ende 1995 90% der 2,725 Mio. Einwohner an kommunale Kläranlagen angeschlossen. In diesen wurden 182 Mio. m3 Schmutzwasser behandelt, von denen 51 Mio. m3 aus gewerblichen Einleitungen stammten. 12 13
Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten (MUNF) führte die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, Institut für Tiergesundheit und Lebensmittelqualität der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LUFA-ITL Kiel) eine Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins durch. Mit dieser Erhebung wurden insbesondere auch die Daten über die nicht landwirtschaftlich verwerteten Klärschlämme erfasst, die aufgabenbedingt im Klärschlammkataster der LUFA nicht vorliegen. Die Verteilung der insgesamt 908 erfassten Anlagen nach Gebietskörperschaften bzw. ihre Zuordnung nach Größenklassen ist Tabelle 2 zu entnehmen.
Tabelle 2: Anzahl der erfassten Kläranlagen [nach Größenklassen]
Quelle: LUFA-ITL Kiel (1999): Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen in S-H
für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
12 Zum Vergleich von gewerblichem oder industriellem Abwasser mit häuslichem Abwasser wird der Einwohnergleichwert (EGW) herangezogen. Er gibt an, wie viele Einwohner eine entsprechende Menge gewerbliches oder industrielles Abwasser erzeugt hätten. Die Kläranlagenkapazität Schleswig-Holsteins beträgt 1995 4,2 Mio. EGW. Die Summe der an eine Abwasserbehandlungsanlage angeschlossenen Bevölkerung (E) und der behandelten Einwohnergleichwerte (EGW) ergibt den Einwohnerwert (EW) einer Kläranlage (E + EGW = EW).
13 Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.) (1995): Statistische Berichte zur öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Schleswig-Holstein im Jahre 1995, Teil 2: Statistik der öffentlichen Abwasserbeseitigung.
Die Flächenkreise Dithmarschen, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein, Schleswig-Flensburg und Segeberg weisen die höchste Anzahl an Anlagen auf. Die Anlagen der Größenklasse 5 (> 100.000 EW) sind diejenigen der kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg sowie die Anlagen Stadt Rendsburg, Stadt Geesthacht, Hetlingen (Abwasserzweckverband Pinneberg) und Glückstadt-Süd.
4.2 Klärschlammaufkommen
Dem von der LUFA-ITL Kiel erstellten Bericht zufolge liegt das Klärschlammaufkommen aus kommunalen Kläranlagen in Schleswig-Holstein in den Jahren 1993 - 1997 im Mittel bei ca. 129.000 Megagramm (Mg) Trockensubstanz (TS) pro Jahr (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Klärschlammaufkommen in Schleswig-Holstein [in Mg TS]
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):
Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Als Sonderfall muß die kommunale Kläranlage Glückstadt-Süd (Kreis Steinburg) herausgestellt werden, deren Klärschlammaufkommen fast ausschließlich aus der Behandlung gewerblicher Abwässer (Papierindustrie) entsteht (siehe dazu Kapitel 5.1).
Die Mengenangaben zu den kommunalen Klärschlämmen in Mg TS stellen die zurzeit verlässlichste Datengrundlage für Schleswig-Holstein dar, da im Rahmen der Erhebung auch eine grobe Plausibilitätsprüfung des vorliegenden Datenbestandes vorgenommen wurde. Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass mit dieser Erhebung 33 der insgesamt 908 Kläranlagen nicht erfasst werden konnten. Die fehlenden Anlagen sind fast ausschließlich Anlagen aus dem Bereich <1.000 EW, von denen keine Angaben vorliegen. Das Gesamtklärschlammaufkommen ist daher tendenziell geringfügig höher einzuschätzen. Von einer Auswirkung auf die Entsorgungssicherheit ist jedoch nicht auszugehen.
4.3 Klärschlammqualitäten
In der AbfKlärV sind für Klärschlämme, die landwirtschaftlich oder gärtnerisch verwertet werden sollen, Schadstoffgrenzwerte festgelegt. Darüber hinaus sind Grenzwerte für mit Klärschlamm zu beaufschlagende Böden festgelegt. Vor dem erstmaligen Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden und danach im Abstand von 10 Jahren müssen diese Böden untersucht werden.
Die Qualitätsauswertungen der in den Jahren 1993-1997 angefallenen Klärschlämme, die für eine landwirtschaftliche Verwertung vorgesehen waren, wurden auf der Grundlage sämtlicher bei der LUFA-ITL Kiel vorliegenden Analysenergebnisse durchgeführt, unabhängig davon, ob eine Klärschlammverwertung stattgefunden hat oder nicht.
Die Jahresmittelwerte der Klärschlammqualitäten von 1993 bis 1997 sind in Tabelle 4 dargestellt. Die Qualitätsstatistiken der Klärschlammuntersuchungen von 1993-1997 zeigen die überwiegend sehr gute Qualität der Klärschlämme aus Schleswig-Holstein.
Tabelle 4: Jahresmittelwerte der Klärschlammqualitäten
in Schleswig-Holstein (1993-1997)
2) TE = Toxizitäts-Äquivalent der Dioxine und Furane, berechnet nach NATO-CCMS
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999):
Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins für die Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Schadstoffbelastung der in Schleswig‑
Holstein anfallenden Klärschlämme auf Grund der überwiegend ländlichen Struktur des Landes als
relativ gering anzusehen ist. Die meisten Schwermetallgehalte sind in den letzten Jahren gesun‑
ken. Diese insgesamt geringer werdende Belastung der Klärschlämme Schleswig-Holsteins, mit Ausnahme von Kupfer, ist auch als Erfolg der Indirekteinleiterverordnung (IndEVO) 14 zu sehen.
Die Ausnutzung der Grenzwerte gemäß AbfKlärV in den Jahren 1993 bis 1997 ist in Tabelle 5 dargestellt: Die Jahresmittelwerte der Klärschlammqualitäten der Jahre 1993-1997 nutzten die Grenzwerte der AbfKlärV im Mittel zu 14,7 % aus.
Die Schwermetallgehalte der Klärschlämme überschritten nur in Einzelfällen die Grenzwerte der AbfKlärV (durchschnittlicher Ausnutzungsgrad der Grenzwerte der AbfKlärV: 19 %).
Lediglich für Kupfer war eine Häufung der Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen. Die relativ hohen Kupferwerte nutzten die Grenzwerte der AbfKlärV zu durchschnittlich 48 % aus (vgl. Tabelle 5). Kupfer ist im Hinblick auf die Toxizität als wenig problematisch einzustufen. Die steigende Tendenz der Kupferwerte in den Jahren 1993 bis 1997 ist auf Einflüsse der Hausinstallationen zurückzuführen. Auf Grund des relativ hohen Anteils an Neubauten im ländlichen Raum steigen daher die Kupferwerte mit abnehmender Siedlungsdichte. Demzufolge ist die Kupferkonzentration im Abwasser und damit auch im Klärschlamm in kleinen Kläranlagen höher als in großen.
Weitere Grenzwertüberschreitungen wurden nur in Einzelfällen bei Quecksilber (durchschnittlicher Ausnutzungsgrad der Grenzwerte der AbfKlärV: 18,6 %) und Cadmium (durchschnittlicher Ausnutzungsgrad der Grenzwerte der AbfKlärV: 11,6 (23,3) %) (vgl. Tabelle 5) festgestellt.
Von den organischen Schadstoffen überschreitet nur der AOX-Gehalt vereinzelter Klärschlämme den Grenzwert der AbfKlärV (durchschnittlicher Ausnutzungsgrad der Grenzwerte der AbfKlärV: 28,6 %).
14 Landesverordnung über die Genehmigung für das Einleiten von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung - IndEVO) des Landes Schleswig-Holstein vom 17. August 1994 (GVOBl. Schl.-H. 1994, S. 466), aufgehoben durch Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes und des Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz vom 08. Februar2000 (GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 121).
Tabelle 5: Ausnutzung der Grenzwerte der AbfKlärV (Klärschlamm) (1993-1997)
1) nach § 4 Abs. 12 Satz 2 AbfKlärV
2) TE = Toxizitäts-Äquivalent der Dioxine und Furane, berechnet nach NATO-CCMS
Quelle: Veränderte Darstellung nach LUFA-ITL Kiel (1999): Bericht zur Datenerhebung bei den Kläranlagen Schleswig-Holsteins für die
Erstellung des Abfallwirtschaftsteilplanes (AWP) Klärschlamm
Belebtschlamm und Aufwuchs. – Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz, ..... 7.1.8 Biologische Beurteilung des Belebtschlammes. ..... 10 Zitierte Literatur . ...
KKN-Umwelttechnik liefert in die nachfolgenden Gebiete frei Haus. Selbstverständlich führen wir in den unten angegebenen Kreisen, Gemeinden und Städten auch für die Anlagen Einbau- und Einrichtungsarbeiten durch. Außerdem übernehmen wir für unsere SBR-Kleinkläranlagen auch gern die vorgeschriebene Wartung.
Vollbiologische-Kläranlage Krempe
Kunststoff Klärgrube PE-Sammelgrube Herzhorn
Kreis Steinburg SBR-CBR-Kläranlagen Wartung