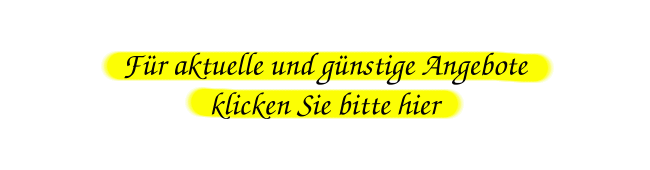- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen im Kunststoff/PE-Tank
- Voll-Biologische Komplett Kleinkläranlagen in Beton-Klärgrube
- Voll-Biologische Kleinkläranlagen als Nachrüstung
- Pflanzenkläranlagen nach DWA
- Beton- Sammelgruben / -Klärgruben
- Kunststoff, PE, Sammel- Klärgruben
- Regenwasser-Zisterne Beton
- Regenwassersammelgrube PE Kunststoff
- Fahrsilo Mistplatten silo-entwässerung
- Wartung Dichtheitsprüfung
- Baden-Württemberg 07903 4060645
- Hamburg 040 29850918
- Niedersachsen 05199 9983960
- Sachsen 034298 480500
(Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen)
Nachrüstsatz FLUIDO (4–50 EW)
SBR-Klärsystem FLUIDO II
zum Einbau in vorhandener Betongrube
VORTEILE:
- Bestehende Gruben einfach nachrüsten – keine Erdarbeiten, geringe Kosten
- geprüftes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie
- geringer Stromverbrauch von nur max. 10 Euro pro Einwohner im Jahr

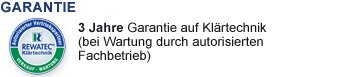
Lieferumfang:
Schwimmkörper mit Tauchbelüfter, Beschickungspumpe, Klarwasserpumpe, Schwimmerschalter, Steuergerät,

Technische Daten: Ø = 48 cm, Höhe = 35 cm über Wasserlinie, Gewicht ca. 20 kg
Preis des Klärmoduls Fluido bis 18 Personen 2.177 € inkl. MwSt.
Listenpreise für diese Anlagentypen:
| SBR-Klärsystem FLUIDO II | Ablaufklasse C | Ablaufklasse D |
€ Preis*
|
|
FLUIDO II basis |
18 EW |
12 EW |
2.177,- |
|
FLUIDO II XL basis |
30 EW |
20 EW |
2.525,- |
|
Doppel FLUIDO II basis |
36 EW |
24 EW |
3.495,- |
|
Doppel FLUIDO II XXL basis |
60 EW |
40 EW |
4.295,- |
Zuzüglich Einbau- und Einrichtungskosten.
Sämtliche Lüftungs-, Zu und Abwasserablaufleitungen, sowie Steuerungs- und Stromkabel müssen in den Boden eingebracht und installiert werden. Daraus ergeben sich natürlich weitere Kosten, die von uns nur vor Ort kalkuliert werden können. Sie wollen den Einbau der SBR-Anlage selbst machen? Pläne für den Selbsteinbau sind bei uns kostenfrei.
Zubehör:
- FLUIDO-Schiene Set-1 für Trennwand Montage inkl. Befestigungs-Set
- FLUIDO-Schiene Set-2 für freie Montage
- FLUIDO-Montage-Set (mit Schwimmstoffschutz)
- SKS-Kompostierung
- ABP-Ausrüstung (Aktive Befüllpumpe) für den Ausgleich von Lastschwankungen (Gewerbe, Gastronomie); geeignet für alle Anlagen mit gekammerter Vorklärung; Steckerfertige Befüllpumpe und Schwimmerschalter mit je 20 m Kabel, Steuergerät Vollversion statt Basisversion, Beschickungs-Schlauch, Entnahmeseil und Befestigungsmaterial; inkl. individueller klärtechnischer Bemessung
- Steuersäule für Außenaufstellung mit Warnleuchte
- Warngerät zur Stromausfallüberwachung (zur Nachrüstung bestehender Anlagen)
Hier die Palette unserer Angebote auf einen Blick:
SBR Pumpen Kleinkläranlage für PE Kunststoff oder Betonklärgrube
SBR Komplett Pumpen Kleinkläranlage zusammen mit PE Kunststoff Klärgrube
SBR Druckluft Hauskläranlage für den Einsatz in Beton- oder Kunststoffklärgruben.
SBR Komplett Druckluft Kleinkläranlage zusammen mit Kunststoff Klärgrube Klärbehältern
SBR SKS Schlammkompostierung in Kleinkläranlage Betonklärgrube Kunststoff Klärgrube
SBR Druckluft Kleinkläranlage mit abgeschlossener Technikkapsel und PE-Kunststoff-Klärgrube
Wirbelschwebebett Hauskläranlage für Einbau in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube
Tauchkörper Hauskläranlage in Beton Klärgrube oder Kunststoff Klärgrube
Festbett-Kläranlage in Beton-Klärgrube oder Kunststoff-Klärgrube
Klärteich Abwasserteich Teich-Kläranlage
Biologische Klärschlamm-Entsorgung
Stromlose Kleinkläranlage in Kunststoff-Klärgrube
Kunststoffklärgrube als 2 oder 3 Kammer Ausfaulgrube
Abflusslose Abwasser Sammelgrube in allen Größen und Formen
Zweikammer Beton Klärgruben für SBR Kleinkläranlagen
Dreikammer Beton Klärgrube Ausfaulgrube
Verrieselung Versickerung als Abwasserentsorgung in den Untergrund für Kläranlagen
Verrieselungs-Schacht Versickerungs-Schacht Sickerschacht für Kleinkläranlagen
Pumpen, Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe Fäkalpumpe Abwasserpumpe
Verdichter / Kompressoren LP80, LP120, für SBR-Kläranlagen
Sanierung Kleinkläranlagen, Betonklärgruben, Abwasserleitungen
Dichtheitsprüfung für Kläranlagen Abwasseranlagen Klärgruben Abwasserleitungen
Sanierung von Kleinkläranlagen Abwasserleitungen Klärgruben Haus-Abflussleitungen
INFOKlein
Allgemeines über Kleinkläranlagen
· Bau
· Betrieb
· Nachrüstung 2000
Wasserwirtschaftliche und bauliche Erfordernisse
beim Neubau oder bei der Nachrüstung einer Kleinkläranlage
einschließlich der biologischen Nachreinigung
INFORMATIONSSCHRIFT
|
Abwasser und Abfallüberwachung |
Welche Vorschriften sind zu beachten?
I. Gesetzliche Grundlagen 5
Welche Planungsgrundsätze sind zu berücksichtigen?
II. Abwasseranfall / Bemessungsgrundlagen 7
1. Einleitung des Abwassers in die Kläranlage 7
2. Bemessungsgrundlagen 7
Was muß ich beim Bau beachten?
III. Baugrundsätze 7
1. Kläranlage 8
2. Die biologische Nachreinigung 9
2.1 Allgemeine Bemerkungen 9
2.1.1 Kläranlage mit biologischer Nachreinigung 9
2.1.2 Vollbiologische Reinigungsstufe mit Vorreinigung 9
2.2 Bautechnische Grundsätze 10
a) Filtergraben 10 +Anlage 1
b) Untergrundverrieselung 10 +Anlage 2
c) Tropfkörper 11 +Anlage 3
d) Belebtschlammanlage 11 +Anlage 4
e) Nachklärteiche 11 +Anlage 5 + 6
f) Pflanzenbeete 12 +Anlage 7
g) Sonstige Maßnahmen
Was müssen Landwirte zusätzlich berücksichtigen?
IV. Besonderheiten landwirtschaftlicher Betriebe 13
1. Reinigung des Oberflächenwassers in Klärteichen 13
2. Milchkammerabwasser 13
Was ist für Sie die beste Lösung?
V. Klärsystem im Vergleich 14
Was muß ich für meine Kläranlage tun?
VI. Die Wartung und Entschlammung 15
1. Wartung 15
2. Entschlammung 15
Welche Vorschriften sind zu beachten?
I. Gesetzliche Grundlagen
Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik zu errichten und zu betreiben. Entsprechen vorhandene Abwasseranlagen nicht diesen Anforderungen, so müssen sie entsprechend nachgerüstet werden (§ 18 b Wasserhaushaltsgesetz
Die Einleitung von Abwasser in das Grundwasser oder in ein Oberflächengewässer bedarf grundsätzlich der wasserbehördlichen Erlaubnis (§§ 2 und 3 WHG).
Diese Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die Verschmutzung so gering gehalten wird, wie dies bei Anwendung von Abwasserreinigungsverfahren nach dem Stand der Technik möglich ist (§ 7 a WHG). Der Stand der Technik für Kleinkläranlagen ist die DIN 4261. Diese ist wie folgt gegliedert:
Teil 1: Kleinkläranlagen, Anlagen ohne Abwasserbelüftung, Anwendung, Bemessung und Ausführung
Teil 2: Kleinkläranlagen, Anlagen mit Abwasserbelüftung, Anwendung, Bemessung, Ausführung und Prüfung
Teil 3: Kleinkläranlagen, Anlagen ohne Abwasserbelüftung, Betrieb und Wartung Teil 4: Kleinkläranlagen, Anlagen mit Abwasserbelüftung, Betrieb und Wartung
Diese Norm ist somit maßgebend für die Bemessung, den Bau und den Betrieb von Abwasserreinigungsanlagen auf nicht zentral entsorgten Grundstücken. Sie gilt nicht nur für den Bau von Abwasseranlagen, sondern auch für vorhandene, genehmigte und nicht genehmigte Anlagen.
Die Gemeinden sind zur Abwasserbeseitigung im Rahmen der Selbstverwaltung verpflichtet (§ 31 LWG). Sie regeln die Abwasserbeseitigung durch Satzung. In diesem Zusammenhang erstellen die Gemeinden ein Konzept, in dem sie die Zielvorstellungen zur Abwasserbeseitigung auf dem gesamten Gebiet, die Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung und die dafür vorgesehenen Zeiträume festlegen.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob ein Abwasserkonzept vorliegt oder ob in der Ortssatzung
· die Art der Abwasserbeseitigung auf Ihrem Grundstück geregelt ist,
· Fristen für Anpassungsmaßnahmen festgelegt sind,
· eine Genehmigung für den Bau und die Änderung von Kläranlagen oder für den Anschluß an das Kanalisationsnetz vorgeschrieben ist.
Das zum Schutz der Gewässer in den Wassergesetzen verankerte Minimierungsgebot wird also erfüllt, wenn Ihre Hauskläranlage der DIN 4261 entspricht.
Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigungsanlage für häusliches Abwasser gehört daher grundsätzlich eine Kläranlage und eine biologische Nachreinigung.
Diese gesetzlichen Regelungen gelten für jedes nicht an die gemeindliche Kanalisation angeschlossene Grundstück, ohne daß es einer besonderen Aufforderung durch die Wasserbehörde bedarf.
Der Bauherr haftet für eine ausreichende Reinigung des Abwassers.
Welche Planungsgrundsätze sind zu berücksichtigen?
II. Abwasseranfall / Bemessungsgrundlagen
1. Einleitung des Abwassers in die Kläranlage
Sämtliches im Haushalt anfallendes Abwasser muß in die 1. Kammer der Kläranlage eingeleitet werden, also auch das Abwasser der Küche, der Waschküche und des Bades. Ausgeschlossen ist das Regenwasser.
In die Kläranlage soll nur das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Abwasser eingeleitet werden. Nicht eingeleitet werden dürfen Stoffe, die den Klärprozeß beeinträchtigen können, wie z.B. feste Stoffe, chemische Stoffe, Fette, Öle, Säuren, Arzneimittelreste, scharfe Reinigungsmittel usw.
2. Bemessungsgrundlagen
Kleinkläranlagen für Wohngebäude sind nach der Anzahl der darin wohnenden Einwohner zu bemessen. Je Wohneinheit mit einer Wohnfläche über 50 m2 ist jedoch mit mindestens vier Einwohnern und je Wohneinheit mit einer Wohnfläche bis 50 m2 mit mindestens zwei Einwohnern zu rechnen. Bei allen anderen Häusern (Büros, Werkstätten, Gaststätten usw.) sind die entsprechenden Einwohnergleichwerte nach DIN 4261, Teil 1, Ziffer 4.3, zu berechnen.
Kläranlagen müssen einen nachfolgend aufgeführten nutzbaren Inhalt aufweisen:
a) bei einer biologischen Nachreinigung über eine Untergrundverrieselung, einen Filtergraben oder ein Pflanzenbeet 1,5 m3 / Einwohner (Mindestgröße: 6 m3),
b) bei einer biologischen Nachreinigung über eine Tropfkörper, Belebtschlammanla‑
ge bzw. einen Nachklärteich 1,0 m3 / Einwohner (Mindestgröße: 4,0 m3).
Für diese Größen werden Kläranlagen serienmäßig hergestellt. Die kostengünstige, einmal jährliche Entschlammung ist dann gewährleistet.
Was muß beim Bau beachtet werden?
III. Baugrundsätze
Alle Kläranlagen, die nicht den baulichen Erfordernissen entsprechen, müssen entsprechend angepaßt werden. Die baulichen Voraussetzungen sind in der schon erwähnten DIN 4261 festgelegt. Die Richtlinien sind jedoch so umfangreich, daß sie hier nicht vollständig wiedergegeben werden können. Die o.a. DIN 4261, Teil 1 - 4, kann jedoch im Fachbuchhandel oder durch den Beuth-Vertrieb GmbH, Burggrafenstr. 4 - 10, 10787 Berlin, bezogen werden. Außerdem gibt die Wasserbehörde des Kreises gern alle gewünschten Auskünfte.
Nachfolgend werden nur einige der wichtigsten Vorschriften aufgeführt:
Kläranlage
a) Der Zulauf zur Kläranlage muß rückwärtig über das Dach des Wohnhauses (Kaminwirkung) entlüftet werden.
b) Die Reinigungsöffnungen der Kläranlage müssen jederzeit zugänglich und dürfen nicht mit Erde, Rasen usw. bedeckt sein. Liegt die Kläranlage im Bereich einer Auffahrt, sind Decke und Abdeckung entsprechend der größeren Belastung stärker als normal auszubilden. Die Abdeckung darf nicht schwerer sein, als sie von einer Person angehoben werden kann.
c) Der Abfluß aus Kammer 3 ist gegen das Abfließen von Schwimmstoffen (Schlamm) durch den Einbau einer Tauchwand oder eines Tauchrohres (Ø 20 cm) zu schützen.
d) Als Übergang von Kammer zu Kammer ist das abgebildete einseitige Tauchrohr am besten geeignet. Schlitze sind nach DIN 4261 auszubilden.
2. Die biologische Nachreinigung
2.1 Allgemeine Bemerkungen
2.1.1 Kläranlage mit biologischer Nachreinigung
In der Kläranlage werden absetzbare Stoffe und Schwimmstoffe zurückgehalten. Es erfolgt zusätzlich ein teilweiser anaerober* Abbau der im Abwasser enthaltenen organischen Schmutzstoffe. Erst in der biologischen Nachreinigung wird das vorgeklärte Abwasser teils durch aerobe*, teils durch anaerobe* biologische Vorgänge nachbehandelt.
Diese biologische Nachbehandlung kann erfolgen durch:
a) Nachschaltung eines Filtergrabens,
b) Nachschaltung einer Untergrundverrieselung,
f) Nachschaltung eines Pflanzenbeetes.
2.1.2 Vollbiologische Reinigungsstufe mit Vorreinigung
In der Kläranlage (Vorreinigung) werden nur die absetzbaren Stoffe (z.B. Schlamm) abgesetzt. Die vollbiologische Reinigung erfolgt aerob* im Kernstück der Anlage unter Zufuhr von Luftsauerstoff.
Diese vollbiologische Reinigung kann erfolgen durch:
c) einen Tropfkörper,
d) eine Belebtschlammanlage,
e) einen Nachklärteich.
* aerob = in Anwesenheit von Luftsauerstoff
* anaerob = in Abwesenheit von Luftsauerstoff (Faulung)
2.2 Bautechnische Grundsätze
Werkmäßig hergestellte Kleinkläranlagen sind prüfzeichenpflichtig. Vor dem Kauf lassen Sie sich bitte das Prüfzeichen nachweisen. !!!
Die bautechnischen Grundsätze entnehmen Sie bitte den Anlagen 1 bis 7 mit folgenden zusätzlichen Hinweisen:
a) Filtergraben (siehe Anlage 1)
Der Filtergraben muß mindestens 50 m vom nächsten Trinkwasserbrunnen entfernt sein. Der Abstand kann bei Einzelbrunnen auf 30 m verringert werden, wenn der Boden bindig ist oder der Filtergraben mit Folie ausgelegt ist. Er ist immer mit Folie auszulegen, soweit der Antragsteller nicht nachweist, daß die Bodendurchlässigkeit geringer als kf 10-7 m/s ist. Der Abstand der unteren Dränage vom Grundwasser muß mindestens 30 cm über dem höchstmöglichen Wasserstand liegen. Bei Zusammenrücken der Rohrstränge auf den Mindestabstand von 1 m ergibt sich ein Filterbeet. Als Filtermaterial ist gewaschener Feinkies 2 - 8 mm zu verwenden.
b) Untergrundverrieselung (siehe Anlage 2)
Die Untergrundverrieselung muß mindestens 50 m vom nächsten Trinkwasserbrunnen (auch auf den Nachbargrundstücken) entfernt bleiben. Der Abstand zum Grundwasser (Anlage 2 Nr. 13) ist zu beachten und nachzuweisen. Die Untergrundverrieselung wird bei Grundstücken nur zugelassen, wenn keine Ableitung in ein Fließgewässer möglich ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn das Fließgewässer weiter als 200 m entfernt ist. Die Untergrundverrieselung ist in festgesetzten oder geplanten Wasserschutzgebieten ausgeschlossen.
Zu a) und b): Stoßweise Beschickung
Gemäß Einführungserlaß des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung vom 23.06.1992 wird für die DIN 4261 unter anderem bei Neuanlagen oder Erweiterungen die stoßweise Beschickung zwingend vorgeschrieben. Hierzu eignen sich Hebersysteme (Kippheber, Pumpen). Bei den Kipphebern ist ein Höhenverlust von ca. 35 cm zu berücksichtigen. Die stoßweise Beschickung mittels einer Pumpe arbeitet höhenunabhängig. Bei jedem Beschickungsvorgang muß der Rohrquerschnitt zu 1/4 gefüllt werden. Daraus ergeben sich bei Sandfiltergraben
je Wohneinheit ca. 50 l je Beschickung und bei Verrieselung im Sandboden je Wohneinheit ca. 80 l je Beschickung.
c) Tropfkörper (siehe Anlage 3)
Die Tropfkörper werden von Fachfirmen in Fertigbauweise (meist rund) angeboten. Planunterlagen und Auskünfte über technische Details erhalten Sie bei den Anbietern.
Weitere Varianten sind der Tauchkörper und getauchte Festbettanlagen.
d) Belebtschlammanlage (siehe Anlage 4)
Die Belebtschlammanlagen werden von Fachfirmen in Fertigbauweise angeboten. Planunterlagen und Auskünfte über technische Details erhalten Sie bei den Anbietern. Diese Anlagen sollten erst bei mehreren Wohneinheiten verwendet werden.
e) Nachklärteiche (siehe Anlagen 5 + 6)
Dem Nachklärteich (in der DIN 4261 nicht enthalten) ist eine Kläranlage (Hauskläranlage) mit einer Mindestgröße von 4 m3 bzw. 1 m3 pro Einwohner vorzuschalten. Die Mindestgröße des Nachklärteiches muß 100 m2 Wasserfläche bei einer Wassertiefe von 1,20 m betragen. Die weitere Bemessung hat nach Tabelle 1 (Anlage 6) zu erfolgen. Es werden in etwa 20 m2 Teichfläche je Einwohner benötigt. Diese Werte liegen auf der sicheren Seite, so daß kurzfristige Änderungen der Belastungen ohne Auswirkung auf die Qualität des ablaufenden Abwassers bleiben. Der Wasserspiegel des Nachklärteiches darf nicht tiefer liegen als der Grundwasserspiegel. Wenn der Teichwasserspiegel wesentlich über bzw. im schwankenden Grundwasserspiegel liegt und der anstehende Boden durchlässig ist, so ist der Teich zum Schutz des Grundwassers künstlich zu dichten.
Die Wasserbehörden der Kreise Schleswig-Holsteins halten solche Nachklärteiche im Außenbereich für eine sinnvolle, günstige Alternative zu den in der
DIN 4261 angegebenen Möglichkeiten. Dabei wird auf DIN 4261, Teil 1, Abs. 3.1.4 „Sonstige Nachbehandlung“, Bezug genommen.
Der Abstand soll mindestens 25 m zum bewohnten Gebäude (auch Nachbargebäude betragen). Bei einem Abstand unter 50 m ist jedoch das Einverständnis des Grundstücksnachbarn einzuholen. Der Abstand soll zum Knick und zu Gehölzgruppen mindestens 5 m und zu Gewässern mindestens 10 m betragen. Bei Anlagen an klassifizierten Straßen ist das Straßen- und Wegerecht Schleswig-Holstein zu berücksichtigen.
Das Abwasser des Nachklärteiches darf jedoch nicht mit dem Wasser in einem Fischteich oder in einem unbelasteten Feuchtbiotop verwechselt werden. Wegen seines fäkalen Ursprungs ist das Abwasser im Nachklärteich grundsätzlich hygienisch bedenklich. Aus hygienischer Sicht muß ein direkter Kontakt von Personen
mit dem Abwasser (z.B.) Einzäunung ausgeschlossen werden. Für spielende Kinder kann der Nachklärteich eine besondere Verlockung und damit Gefahr darstellen.
f) Pflanzenbeete (siehe Anlage 7)
Dem Pflanzenbeet (in der DIN 4261 nicht enthalten) ist eine Kläranlage mit einer Mindestgröße von 6 m3 bzw. 1,5 m3 pro Einwohner vorzuschalten. Als Nettomindestfläche der Pflanzenbeete sind 5 m2 pro Einwohner bzw. mindestens 25 m2 Gesamtgröße anzusetzen. Die Abwasserbeschickung ist nur im Unterflußsystem vorzusehen, ggf. ist entsprechender Stauraum vorzusehen, damit kein Abwasser über die Oberfläche der Beete abfließt.
Die Beete sollen aus sandig-kiesigem Boden bestehen. In der Regel sind die Beete zum Schutz des Untergrundes durch Folie abzudichten.
Regenwasser darf nicht eingeleitet werden.
Der Abstand soll mindestens 25 m zum nächsten bewohnten Gebäude betragen. Wird dieser Mindestabstand unterschritten, so wird eine Förderung im Zuge der Nachrüstung nicht gewährt. Des weiteren sollen die Pflanzenbeetanlagen keinen geringeren Abstand zum bewohnten Nachbargebäude aufweisen als zum bewohnten Gebäude des Abwasserproduzenten selbst. Der Abstand soll zum Knick und zu Gehölzgruppen mindestens 5 m und zu Gewässern mindestens 10 m betragen. Bei Anlagen an klassifizierten Straßen ist das Straßen- und Wegerecht Schleswig-Holstein zu berücksichtigen. Das Einverständnis der Grundstücksnachbarn bewohnter Grundstücke muß vor Baubeginn eingeholt werden. Dies gilt auch für Baulücken. In besonders begründeten Fällen können Ausnahmen durch die Wasserbehörde zugelassen werden.
Für die Planung und Bauüberwachung kommen nur versierte Fachleute in Betracht. Der Anlagenplaner oder -anbieter muß eine Gewährleistung für die Funktion der Anlage nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) - 5 Jahre - übernehmen. Die erforderliche Reinigungsleistung ist spätestens nach kurzer Einarbeitungszeit zu erreichen und nicht erst nach 1 bis 3 Jahren.
Auf die Erlasse des Ministeriums für Natur, Umwelt und Landesentwicklung des Landes Schleswig-Holstein vom 10.02.1990 zur Zulassung von Pflanzenbeeten und vom 05.07.1990 mit Hinweisen zur Zulassung von Pflanzenbeeten sowie auf das Hinweisblatt der ATV H 262 wird hingewiesen.
g) Sonstige Maßnahmen
Diese bedürften der Typengenehmigung bei Serienherstellung oder der Zulassung der Wasserbehörde im Einzelfall.
Was müssen Landwirte zusätzlich berücksichtigen?
IV. Besonderheiten landwirtschaftlicher Betriebe
1. Reinigung des Oberflächenwassers in Klärteichen
Bei landwirtschaftlichen Betrieben, deren Hof- und Dachabwässer den Klärteichen zugeleitet werden, sind gemäß Tabelle 2 (Anlage 6) Zuschläge zu machen. Danach ist die Teichfläche zu ermitteln.
Silagesäfte und Sickerjauche von den Dungplatten dürfen ebensowenig in die Kleinkläranlage oder den Nachklärteich eingeleitet werden wie Jauche und Gülle.
2. Milchkammerabwasser
Bei landwirtschaftlichen Betrieben ergibt sich oftmals die Frage nach dem Vertrieb des Abwassers aus der Milchkammer (Spülwasser). Dieses ist den Jauche- bzw. Güllebehältern zuzuleiten. Allerdings ist hierbei der erhöhte Bedarf hinsichtlich der Größe des Jauche- bzw. Güllebehälters zu berücksichtigen und nachzuweisen.
Zusätzlicher Inhalt des Jauche- bzw. Güllebehälters:
|
Abwasseranfall |
Zusätzlicher Inhalt des Jauche- bei 1/2jährlicher Entleerung |
bzw. Güllebehälters bei jährlicher Entleerung |
|
bis 30 Milchkühe 120 l / Tag |
22 m3 |
44 m3 |
|
bis 60 Milchkühe 200 l / Tag |
37 m3 |
73 m3 |
|
bis 90 Milchkühe 250 l / Tag |
46 m3 |
91 m3 |
Eine Ableitung des Abwassers aus der Milchkammer in die Kläranlage ist nicht zulässig.
Was ist für Sie die beste Lösung?
V. Klärsysteme im Vergleich
Die Kläranlagen mit Filtergräben oder Untergrundverrieselung sind für kleine Einheiten (bis 10 Einwohner) kostengünstig. Der Wartungsaufwand ist vergleichsweise gering. Die Standzeiten (Lebensdauer) richten sich nach den tatsächlichen Belastungen, sind dadurch unterschiedlich und betragen ca. 8 bis 14 Jahre. Der Flächenbedarf beträgt bei Filtergräben 6 m2 / Einwohner und bei der Untergrundverrieselung 20 bis 40 m2 / Einwohner.
Die Untergrundverrieselung wird durch den Grundwasserschutz (vor Nitrateintrag) und durch die Mindestabstände zu Trinkwasserbrunnen (in der Regel 50 m) zusätzlich eingeschränkt. Die Erlaubnis wird nur in Ausnahmefällen erteilt, wenn das nächste Fließgewässer weiter als 200 m entfernt ist.
Wegen der etwas aufwendigeren Technik, die eine vergleichsmäßige Belastung und eine fachkundige Wartung voraussetzt, kommen die Tropfkörper im allgemeinen erst ab 8 Einwohnern und die Belebtschlammanlagen erst ab ca. 30 Einwohnern zum Einsatz.
Der Nachklärteich bringt eine hohe Reinigungsleistung bei niedrigen Betriebskosten. Wegen seines hohen Flächenbedarfs und der Einschränkungen aus hygienischer Sicht (Ziffer 2.2 e) bleibt die Anwendung jedoch auf den Außenbereich beschränkt.
Eine Sonderstellung nehmen die Pflanzenbeete ein. Sie wurden erst 1990 zugelassen. Der Flächenbedarf ist geringer als bei Nachklärteichen; dafür sind die Anforderungen an Planung, Bau und Wartung höher.
Die höchste Reinigungsleistung zu günstigsten Investitions- und Betriebskosten lassen sich in der Regel immer dann erzielen, wenn mehrere benachbarte Haushalte an eine gemeinsame Kläranlage anschließen. So wird z.B. eine Tropfkörperanlage für
5 Haushalte bei wahrscheinlich höherer Reinigungsleistung sowohl bei den Baukosten als auch bei den Betriebskosten pro Haushalt günstiger liegen als wenn
5 Filtergrabenanlagen für 5 Haushalte gebaut werden.
WWas muß ich für meine Kläranlage tun?
VI. Die Wartung und Entschlammung
1. Wartung
Der große Aufwand für die Abwasserreinigung zahlt sich nur dann für den Gewässerschutz aus, wenn Sie den Betrieb einer Anlage überwachen. Verstopfungen und bauliche Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.
In Kleinkläranlagen ist mit der Bildung schädlicher Gase zu rechnen. Darauf ist bei der Reparatur zu achten (Unfallverhütungsvorschriften).
Der Filtergraben bzw. die Untergrundverrieselung ist mindestens zweimal jährlich auf einwandfreie Funktion der Lüftungsleitungen und der Ablaufleitungen (kein Aufstau
in den Sickersträngen) zu prüfen.
Pflanzenbeete sind mindestens zweimal jährlich auf ausreichende Versickerung im Bereich der Einlaufkulisse zu überprüfen. Es darf kein Aufstau in der vorgeschalteten Kläranlage und kein Abfluß über die Beetoberfläche erfolgen (Hinweisblatt ATV H 262).
Die Störungsleuchte für die Abwasserhebepumpen in der Tropfkörperanlage und Belebtschlammanlage ist wöchentlich auf ihre Funktion zu prüfen.
Störungen bei den Abwassertauchpumpen sind sofort zu beseitigen. Wenn die Abwassertauchpumpen bei Tropfkörperanlagen nicht in Betrieb sind, ist der Tropfkörper außer Funktion und verschlammt sehr schnell.
Im übrigen sind die Auflagen im Erlaubnisbescheid bezüglich der Wartung zu beachten.
Der Abschluß eines Wartungsvertrages ist bei allen technischen Anlagen wie Tropfkörperanlagen , getauchten Festbettanlagen , Tauchkörperanlagen und bei Belebtschlammanlagen erforderlich!
2. Entschlammung Die Entschlammung der Kläranlage wird seit dem 01.01.1992 durch die Gemeinde
oder den Wegezweckverband durchgeführt. Bei der Entschlammung, deren Häufigkeit sich nach der Satzung der Gemeinde richtet, ist zunächst die Schwimmschlammdecke aller Kammern zu entfernen. Bei der anschließenden Schlammentnahme soll in allen Kammern ein vermischter Restschlamm von etwa 30 cm Höhe als Impfschlamm verbleie
LinktipsUmfassenden Überblick über Erfahrungen und zugehöriger Untersuchung gibt der folgende Link in Englisch: http://www.stockholmvatten.se/pdf_arkiv/english/Urinsep_eng.pdf Ergebnisse einer Untersuchung zur Fäkalientrennung: http://www.wupperverband.de/forschung/lambert/deutsch/Projekt/ projektergebnisse.htm#Gelbwasser Separationstoiletten wie sie früher genutzt wurden Verdunstung des Urins mittels Lehmwand:
|
Selbstverständlich führen wir auch für die Anlagen Einbau- und Einrichtungsarbeiten durch. Außerdem übernehmen wir für unsere SBR-Kleinkläranlagen auch gern die vorgeschriebene Wartung.